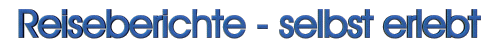Gemächlich durch die Zeitzonen - mit Speed durch die Landschaft
Tokio
Meine Zugnachbarin empfiehlt mir, mit der Yamanote-Linie zum gebuchten Hotel in Ikebukuro zu fahren. Die Orientierung im Hauptbahnhof ist gewöhnungsbedürftig angesichts der vielen verschiedenen Linien und Anbieter. Aber freundliche Mitarbeiter helfen mir weiter und so sitze ich schließlich im richtigen Zug. Nun ist es wieder einfach, die Bahnhöfe werden angezeigt und auch per Lautsprecherdurchsage bekannt gegeben. An meiner Zielstation, wieder eine überdimensionale unterirdische Landschaft, frage ich nach dem richtigen Ausgang und erfahre, dass ich den Bahnhof über C 6 verlassen sollte. Bis zum Hotel „Sakura“ ist es nicht weit, aber ich muss mich doch ein paar Male durchfragen. Vollkommen durchgeschwitzt belege ich mein Zimmer. Auch hier liegt wieder ein Schlafanzug auf dem Bett, die Toilette hat verschiedene Säuberungsstrahlen und auch eine Bidetfunktion, genau wie in Kyoto. Durch das viele Schwitzen und die permanente Aircondition habe ich mir einen kleinen Schnupfen geholt. Zum Lesen der Emails bin ich wieder gezwungen, in die Lobby zu gehen, aber das ist sicherlich kein Problem.
Tokio, häufig auch als Tokyo zu lesen, hat 14 Millionen Einwohner, im Großraum leben 35 Millionen Menschen und damit handelt es sich um das größte zusammenhängende urbane Gebiet der Welt. Die Stadt ist aufregend, traditionell, fesselnd und einzigartig. Eine Megacity oder ein Moloch, bestehend aus 23 Verwaltungsbezirken, die es unmöglich machen, von einem Erscheinungsbild zu sprechen. „Mein“ Bezirk Ikebukuro war früher bekannt für gutes Essen, interessante Lokale und Unterhaltung, mittlerweile haben sich andere Szeneviertel etabliert. Dennoch kann ich über die Anzahl der Restaurants und anderen gastronomischen Betriebe nicht klagen. Wenn ich abends durch die Straßen gehe und mir die aufwändige Neon-Beleuchtung und –Werbung ansehe, denke ich: Genauso habe ich mir Tokio vorgestellt.
In der Nähe meiner Unterkunft befindet sich auch ein so genanntes „Love Hotel“, ein Resultat der beengten häuslichen Wohnsituation, wo dünne Holzwände nicht unbedingt luststeigernd wirken und eine Intimität vermissen lassen, etwa vergleichbar mit den Motels in Südamerika. Auch hier wird absolute Anonymität gewährleistet.
An der Hotelrezeption frage ich nach einem Sushi-Restaurant und mir wird das „Tenka Zushi“ empfohlen. Es ist gar nicht weit, dennoch verlaufe ich mich und frage einen jungen Mann nach dem Weg. Er nimmt sein Handy, gibt den Namen des Lokals ein und – zeigt mir den falschen Weg. Irgendeine Eingabe muss dann wohl falsch gewesen sein. Dann frage ich einen älteren Herrn, er schaut auf den Plan und winkt mir, ihm zu folgen. Ein paar Minuten später stehen wir vor dem Eingang, ich hätte den Betrieb nicht gefunden, da die Reklame nur in japanischer Sprache leuchtet. Der runde Tresen ist bis auf den letzten Platz besetzt und zehn Personen, darunter ein Paar aus den USA, das nachmittags schon einmal hier gegessen hat, warten auf einer Holzbank, dass sie an die Reihe kommen. Nach einer Viertelstunde darf auch ich mich an den Tresen setzen. Ein Kellner reicht mir die Speisekarte und meine freundliche Nachbarin erklärt mir, wie ich zu einem Glas Tee komme. Ich bestelle mir zwei Gerichte von der Karte und nehme mir anschließend noch ein paar Speisen vom Karussell. Es schmeckt mir sehr gut und auch über den Preis kann ich mich nicht beklagen. Japan ist längst nicht so teuer, wie ich geglaubt habe oder wie mir suggeriert wurde.
Heute leiste ich Schwerstarbeit: Tokio auf eigene Faust mit öffentlichen Verkehrsmitteln und ohne Schrift- bzw. Sprachkenntnis. Der freundliche Mann an der Hotel-Rezeption ist mir bei der Planung behilflich und nennt mir die günstigsten Verbindungen. Im Bahnhof „Tokyo“ reihe ich mich in eine nicht enden wollende Schlange ein und erwerbe nach langer Wartezeit den „Tokuma-Pass“. Damit kann ich den ganzen Tag die Yamanote-Linie nutzen. Auch kaufe ich hier das Ticket für den Narita-Express, mit dem ich morgen zum Flughafen fahren werde. Zunächst geht es zum Sensōji-Tempel, dem bedeutendsten Tempel der Stadt. Einmal muss ich umsteigen, am Automaten ein Ticket für die Ginza-Linie ziehen, was mir nach anfänglicher Skepsis gelingt, und dann mit der Metro weiter bis Asahasa. Was ist hier nur los, Hunderte wenn nicht gar Tausende zumeist einheimische Besucher, die Damen akkurat unter einem Sonnenschirm, verfolgen dasselbe Ziel. Im Reiseführer lese ich, dass jährlich 30 Millionen Gäste diese Anlage besichtigen, aber es lohnt sich auch. Wir gehen durch das Kaminarimon-Tor mit der großen Laterne. Die Haupthalle wurde 645 gebaut, die Pagode daneben darf ich leider nicht betreten. Auf dem Weg zurück betrachte ich die Auslagen, Souvenirs etc. in den Ständen zu beiden Seiten der Straße, hier Nakamise genannt.
Dann zurück zur Station „Tokyo“ und in der brütenden Mittagshitze, wo man wirklich dankbar für jeden noch so kleinen Schatten ist, zu Fuß weiter zum Kaiserpalast. Besichtigt werden kann nur die Gartenanlage, der Besuch weiterer Gebäude wird uns nicht gestattet. Nachdem ich das Tor passiert habe, erhalte ich einen kostenlosen Besucherschein von einem Wachmann. Ich bin etwas enttäuscht, da ich, genau wie in Kyoto, auch hier den Palast nicht besichtigen kann. Der Garten, in dem sich vielleicht 20 weitere Besucher aufhalten, ist für mich nicht so interessant, abgesehen von den schönen Spiegelungen im See.
Anschließend gehe ich zurück zum Bahnhof und fahre weiter zum Tokio Tower, vergleichbar mit dem Eiffelturm. Man kann durchaus höhere Ausblicke auf die Stadt genießen, besonders vom Skytree, aber dieser Turm hat Charme. Heute fahren wir nur auf 150 Meter hinauf, die zweite Plattform in 250 Meter Höhe ist wegen starken Windes gesperrt. Mir macht es nichts aus und so erhalte ich einen umfassenden Blick auf die Stadt und erkenne sogar ein ganz klein wenig den Fujiyama. Sein unterer Teil ist noch nicht in Wolken verhüllt. Zurück in Ikebukuro habe ich Probleme, den richtigen Ausgang aus dem riesigen Bahnhof zu finden. An diese Dimensionen, an die Menschenmassen, jeder mit Blick auf sein Handy, muss man sich als Europäer erst gewöhnen. Das Gewühl in den Stationen, die nicht enden wollenden akustischen Hinweise, das Fremde, hier braucht man gute Nerven.
Abends gehe ich wieder in das schon bekannte Sushi-Lokal und nehme dann in der Hotelbar noch ein paar Drinks. Zwei junge Damen bitten mich um ein Selfie mit ihnen. Am Nebentisch wird Geburtstag gefeiert, auch ich erhalte ein Stück vom Geburtstagskuchen. Ein Gast aus Tibet und eine Frau aus Myanmar, sie nennt es noch Burma, feiern mit, kommen kurz an meinen Tisch und beklagen die Unfreiheit in ihrer Heimat. Sie wohnen seit über fünf Jahren in Japan und haben ihre Familien seitdem nicht mehr gesehen.
Nach einer kurzen Nacht wache ich gerädert auf. Gut, dass ich meinen Wecker gestellt hatte, denn der Hotel-Weckdienst hat versagt. Zunächst fahre ich mit dem Narita Express zum Flughafen und fliege dann mit einem Airbus der China Eastern nach Shanghai. Eine sehr freundliche Stewardess bietet mir einen anderen Platz an, als ich sie frage, ob denn der Fuji zu sehen sei. Aber trotz gutem Sichtfeld nehme ich den Berg nur ansatzweise wahr.